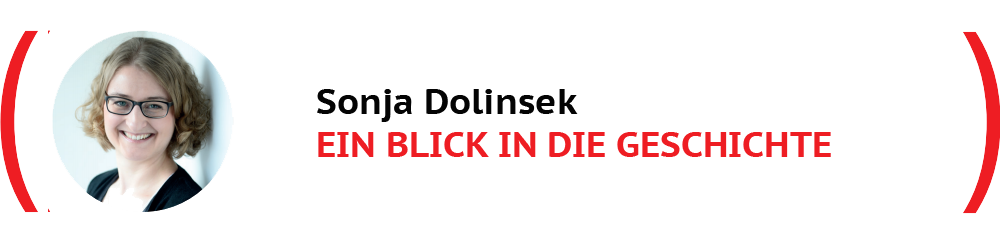 Die Geschichte der Prostitutionspolitik in Deutschland ist eine Geschichte der Kontrolle, der Repression und der gesellschaftlichen Marginalisierung. Über Jahrhunderte hinweg war der staatliche Umgang mit Sexarbeit weniger von einem Schutzgedanken als von ordnungspolitischen und moralischen Vorstellungen geprägt. Prostituierte wurden als Problem betrachtet, das es zu überwachen, zu reglementieren oder gar zu beseitigen galt. Die aktuellen Debatten zum gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Prostitution zeigen, dass diese Denkweisen weiterhin nachwirken und dass die Politik oftmals auf historische Muster zurückgreift, anstatt neue, progressive Lösungen zu entwickeln.
Die Geschichte der Prostitutionspolitik in Deutschland ist eine Geschichte der Kontrolle, der Repression und der gesellschaftlichen Marginalisierung. Über Jahrhunderte hinweg war der staatliche Umgang mit Sexarbeit weniger von einem Schutzgedanken als von ordnungspolitischen und moralischen Vorstellungen geprägt. Prostituierte wurden als Problem betrachtet, das es zu überwachen, zu reglementieren oder gar zu beseitigen galt. Die aktuellen Debatten zum gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Prostitution zeigen, dass diese Denkweisen weiterhin nachwirken und dass die Politik oftmals auf historische Muster zurückgreift, anstatt neue, progressive Lösungen zu entwickeln.
Im Mittelalter wurde Prostitution als notwendiges Übel betrachtet: notwendig, um männliche Triebe zu kanalisieren und die öffentliche Ordnung zu wahren, aber zugleich als moralisch verwerflich. So wurden in vielen deutschen Städten Bordelle reguliert und unter behördlicher Kontrolle gehalten. Die Sexarbeitenden selbst waren nach wie vor stigmatisiert. Mit der Reformation, die außereheliche Sexualität insgesamt kriminalisierte und Sex nur innerhalb der Ehe legitimierte, wurden Prostituierte zunehmend aus den Städten und in die Illegalität verdrängt. Um sexuelle „Verfehlungen“ einzudämmen, setzte man verstärkt auf eine frühe Eheschließung. Die Vorstellung, dass Prostitution weniger eine ökonomische Notwendigkeit als ein individuelles Fehlverhalten sei, prägte fortan den Umgang mit der „Hurerey“ und legte den Grundstein für spätere Kriminalisierungsansätze, die heute noch vor allem in den protestantisch geprägten USA zu finden sind.
Die staatliche Reglementierung der Prostitution in Deutschland begann im 19. Jahrhundert und folgte einer klaren Logik: Prostituierte mussten sich registrieren lassen, waren polizeilicher Überwachung unterworfen und mussten sich regelmäßigen Zwangsuntersuchungen unterziehen. Diese Maßnahmen sollten angeblich die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten eindämmen und die öffentliche Ordnung wahren. In Wirklichkeit bedeuteten sie jedoch vor allem eine tiefgreifende Entrechtung der betroffenen Frauen. Sie verloren durch die Registrierung grundlegende Freiheiten, konnten kaum aus ihrem Beruf aussteigen und waren ständiger polizeilicher Willkür ausgesetzt. Die Untersuchungen hingegen erfolgten ohne hygienische Vorkehrungen, so wie wir sie heute kennen, sodass die Frauen oft durch die Untersuchungen mit sexuell übertragbaren Krankheiten infiziert wurden.
Die sogenannte „abolitionistische“ Bewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts kämpfte gegen diese Form der Kontrolle und erreichte 1927 die Abschaffung der staatlichen Reglementierung. Doch dies bedeutete nicht, dass Prostituierte fortan als gleichberechtigte Bürgerinnen behandelt wurden – dies war nicht das Ziel. Frauen, die sich sexuell auffällig verhielten, also entweder ihre Sexualität auslebten oder Sex für Geld tauschten, sollten nach wie vor diszipliniert werden. Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (1927) sollte Prostitution nicht mehr überwacht werden, vor allem nicht durch die Polizei. Stattdessen wurde die behördliche Registrierung von „Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr“ an die Gesundheitsämter übertragen, die allerdings nach wie vor in erster Linie Prostituierte überwachten. Die Polizei klagte fortan darüber, dass sie nun keine Kontrolle mehr über die Prostitution habe. In der NS-Zeit verschärfte sich die Verfolgung von Prostituierten drastisch und nach und nach wurden Maßnahmen der Reglementierung wieder eingeführt. Gleichzeitig wurden sie als „asozial“ klassifiziert, in Konzentrationslager deportiert oder zwangsweise in Wehrmachtsbordellen eingesetzt. Der Umgang mit Prostitution war Teil einer rassenhygienischen Ordnungspolitik, die der ideologischen Formierung der „Volksgemeinschaft“ diente.
Nach 1945 setzte die Bundesrepublik viele dieser Kontrollmechanismen fort. Das „Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“ von 1953 ermöglichte weiterhin Zwangsuntersuchungen und die Registrierung von Prostituierten. In der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 war die Prostitution offiziell nicht verboten, jedoch blieb sie durch verschiedene rechtliche und gesellschaftliche Mechanismen stark reglementiert. Während Frauen ihr Gewerbe grundsätzlich ohne strafrechtliche Verfolgung ausüben konnten, wurden sie durch das „Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“ von 1953 unter sanitätspolizeiliche Kontrolle gestellt. Gesundheitsämter und Polizei überwachten die Szene und schufen faktisch eine weitreichende Kontrollstruktur. Gleichzeitig setzte sich die Tendenz zur gesellschaftlichen Stigmatisierung und rechtlichen Diskriminierung fort. Sperrbezirke wurden eingeführt, zum Schutz der Jugend und der öffentlichen Ordnung. Das betraf besonders die sichtbare Sexarbeit (Straßenstrich). Daneben wurden verschiedene Gesetze gegen Zuhälterei sowie die Förderung der Prostitution geschaffen. Bis 1973 existierte noch der aus der Kaiserzeit stammende § 361 Nr. 6 StGB, der „auffällige öffentliche Unzucht“ unter Strafe stellte.
Erst mit der Strafrechtsreform von 1969/1973 wurden diese repressiven Bestimmungen weitgehend aufgehoben. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung der frühen Bundesrepublik spielte die Gegenüberstellung von Prostitution und der idealisierten, monogamen Ehe eine zentrale Rolle. Die Dirne galt als negatives Gegenbild zur sittlichen, familienorientierten Frau. Diese Sichtweise beeinflusste nicht nur das Strafrecht, sondern auch die öffentliche Moral und Gesetzgebung.
In der Bundesrepublik wurde Prostitution vor allem als Problem der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Sicherheit betrachtet, während die abolitionistische Haltung an Bedeutung verlor und nahezu in Vergessenheit geriet. Zwar entsprach die deutsche Gesetzgebung in Teilen den abolitionistischen Prinzipien, etwa durch das Verbot von Bordellen und die formale Abschaffung der polizeilichen Registrierung von Prostituierten im Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten von 1953. In der Praxis wurden diese Vorgaben jedoch oft umgangen: die kriminalpolizeiliche Erfassung von Sexarbeitenden blieb bestehen und Bordelle existierten unter der Bezeichnung „Dirnenwohnheime“ weiter. Besonders die Polizei sah ein striktes Verbot der Prostitution, ebenso wie ihre Deregulierung als unrealistisch an und plädierte für eine ordnungspolitische Kontrolle der Sexarbeit durch räumliche Einschränkungen (Sperrbezirke) und Überwachungsmaßnahmen.
Diese pragmatische Haltung prägte auch die Debatte um den Beitritt zur 1949 verabschiedeten „Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Ausbeutung der Prostitution anderer“. Die Konvention postulierte eine enge Verbindung zwischen Menschenhandel und regulierter Prostitution und forderte eine umfassende Kriminalisierung der gesamten Infrastruktur der Sexarbeit (Bordelle bzw. Arbeitsorte, Vermietung, Vermittlung). Diese Forderungen stießen in Deutschland auf Widerstand. Behörden, aber auch Sozialarbeiterinnen argumentierten, dass die Kriminalisierung der Wohnungsvermietung an Prostituierte kontraproduktiv sei, da sie die Kontrolle über die Prostitution erschwere und zu einem unkontrollierten „Abdrängen“ von Sexarbeitenden führen könne. Ebenso wurde die Forderung nach der vollständigen Abschaffung von polizeilichen Registrierungsmaßnahmen abgelehnt, da Prostituierte weiterhin als besonders überwachungsbedürftige Gruppe betrachtet wurden – allerdings nicht zu ihrem Schutz, sondern um sie zu kontrollieren.
Erst 2002 brachte das Prostitutionsgesetz (ProstG) eine Liberalisierung. Das Prostitutionsgesetz, das am 1. Januar 2002 in Kraft trat, stellte eine bedeutende Wende in der Prostitutionspolitik dar. Ziel war es, Prostitution aus der Sittenwidrigkeit zu lösen, die Rechte von Sexarbeitenden zu stärken und ihnen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen zu ermöglichen. Die Änderungen wurden als wichtiger Schritt zur rechtlichen und sozialen Gleichstellung angesehen.
Allerdings geriet das Gesetz bereits kurz nach seiner Einführung in die Kritik. Unterschiedliche gesellschaftliche Akteure bewerteten es entweder als zu weitreichend oder als unzureichend. Kritisiert wurde insbesondere, dass es keine umfassende Regulierung der Sexarbeit enthielt, sondern lediglich die Sittenwidrigkeit aufhob und Prostituierten eine rechtliche Grundlage für die Durchsetzung von Lohnforderungen bot. Auch eine gewerberechtliche Anerkennung oder arbeitsrechtliche Absicherung fehlten, da der Gesetzesentwurf so gestaltet wurde, dass er keiner Zustimmung durch den Bundesrat bedurfte. Dies führte dazu, dass zentrale Bereiche der Regulierung weiterhin den Kommunen überlassen blieben, was zu einer stark fragmentierten Umsetzung des Gesetzes führte.
Mit der 2013 durch Alice Schwarzer initiierten Kampagne „Gegen Prostitution“, wurde das ProstG zunehmend als „gescheitert“ dargestellt, was 2017 zur Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes führte – einer Reform, die in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr zu den Regulierungspraktiken des 19. Jahrhunderts darstellt. Doch weder das ProstG noch das ProstSchG sind wirklich gescheitert. Vielmehr gehen beide Gesetze in der Anerkennung und arbeits- und menschenrechtsbasierten Regelung der Sexarbeit nicht weit genug. Darüber hinaus müssten andere europäische Staaten nachziehen, damit Sexarbeit in ganz Europa legal ausgeübt werden kann. Die Reform der Prostitutionsgesetzgebung in Belgien in den Jahren 2022–2024 könnte hier als Vorbild wirken.
Das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 sollte Menschenhandel bekämpfen und Sexarbeitende schützen, führte jedoch auch zu mehr staatlicher Kontrolle und Stigmatisierung. Die verpflichtende Anmeldung birgt Risiken des Datenmissbrauchs und die verpflichtenden Beratungsgespräche werden oft als bevormundend, qualitativ unzureichend oder demütigend empfunden. Gleichwohl sind – theoretisch – alle registrierten Sexarbeitenden über ihre Rechte informiert, inklusive der Tatsache, dass sie niemand zur Prostitution zwingen darf.
Strenge Auflagen für Prostitutionsstätten zwangen gleichzeitig viele selbstorganisierte Arbeitsräume zur Schließung, während Sanktionen gegen nicht angemeldete Sexarbeiter:innen sie in die Illegalität drängen. Statt Schutz zu bieten, erschwert das Gesetz sichere Arbeitsbedingungen – ein Muster, das sich historisch immer wieder zeigt: je stärker die Kontrolle, desto größer die Risiken für jene, die sich ihr entziehen.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass restriktive Maßnahmen in der Sexarbeit meist zur Prekarisierung und Kriminalisierung führten, statt Probleme zu lösen. Für eine wirksame Prostitutionspolitik gilt:
- 1) Zwangsmaßnahmen marginalisieren statt zu schützen. Registrierungspflicht und polizeiliche Überwachung schränken den Handlungsspielraum von Prostituierten ein, statt sie zu stärken
- 2) Kriminalisierung schafft unsichere Arbeitsbedingungen. Verbote verdrängen Prostitution in intransparente Strukturen, was Gewalt und Ausbeutung begünstigt und in höherem Maße polizeiliche Ressourcen bindet, die an anderer Stelle dringend nötig sind
- 3) Sexarbeitende sind Akteurinnen. Maßnahmen müssen mit und nicht über die Betroffenen hinweg entschieden werden. Dabei sollen die Perspektiven der aktiven Sexarbeitenden im Vordergrund stehen
- 4) Menschenhandel erfordert eigene Lösungen. Statt Sexarbeit einzuschränken, sollte der Fokus auf Arbeitsrechte, Opferrechte und Menschenrechte liegen
Ein Blick in die Geschichte zeigt auch, dass in Deutschland fast alle politischen Ansätze zum Umgang mit Prostitution ausprobiert wurden – von der totalen Kontrolle über die Kriminalisierung bis hin zur weitgehenden Deregulierung. Keine dieser Strategien hat zu einem Verschwinden der Prostitution geführt. Stattdessen wiederholen sich bestimmte Kontroll- und Überwachungsmuster, während die eigentlichen Probleme ungelöst bleiben.
Der einzige Ansatz, der fehlt, ist ihre vollständige Integration und Anerkennung – ohne Stigmatisierung.
Eine zukunftsfähige Prostitutionspolitik sollte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und endlich die Perspektiven der aktiven Prostituierten in den Vordergrund stellen, denn sie sind es, die von diesen Regelungen betroffen sind. Sie muss sich von moralisierenden, paternalistischen und repressiven Ansätzen lösen und stattdessen praxisorientierte Lösungen anstreben, die auf die tatsächlichen Bedürfnisse und vielfältigen Lebensrealitäten von Sexarbeiter:innen ein gehen. Nur so kann eine Politik entstehen, die nicht alte Fehler wiederholt, sondern neue Wege geht – im Sinne einer Gesellschaft, die Freiheit, Sicherheit und Würde für alle garantiert.
Anmerkung der Autorin…
Der vorliegende Text beruht auf zahlreichen historischen Studien sowie eigenen Recherchen in Archiven in Deutschland, die hier im Einzelnen nicht genannt werden können. Für einen historischen Überblick zur Geschichte von Prostitutionspolitik empfehle ich folgende Texte zum Einstieg. Darin finden sich Verweise auf weitere Literatur.
- Dolinsek, Sonja/Hearne, Siobhán: Introduction. Prostitution in Twentieth Century Europe, in: European Review of History. Revue européenne d’histoire 29 (2022), S. 121–144. (frei zugänglich)
- Dolinsek, Sonja: Kein Mädchenhandel mehr. Framing Contests in der transnationalen Bekämpfung des Mädchenhandels, in: Henrich-Franke, Christian/Hiepel, Claudia/Thiemeyer, Guido/Türk, Henning (Hg.): Grenzüberschreitende institutionalisierte Zusammenarbeit von der Antike bis zur Gegenwart, Baden-Baden 2019, S. 385–416.
- Gleß, Sabine: Die Reglementierung von Prostitution in Deutschland, Berlin 1999.
- Martin, Annalisa: Vice and Immoral Spaces. German Sperrbezirke, 1949–90, in: Radical History Review 2024 (149), S. 175–199.
- Popp, Andreas: Prostitution. In: Andreas Popp/Arnd Koch/Georg Steinberg (Hrsg.), Strafrecht in der alten Bundesrepublik 1949–1990 – Der Besondere Teil des Strafrechts im zeitgeschichtlichen Spiegel von Gesellschaft und Politik, Baden-Baden 2024, S. 135–166.
Sonja Dolinsek – Historikerin
Sie forscht zur Geschichte von Prostitutionspolitiken im
20. Jahrhundert, insbesondere nach 1945 in Europa und den USA.
Sie arbeitet und lehrt im Bereich Zeitgeschichte an der
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.
Zum Blog von Sonja Dolinsek
Zur Webseite Prostitutionspolitik
